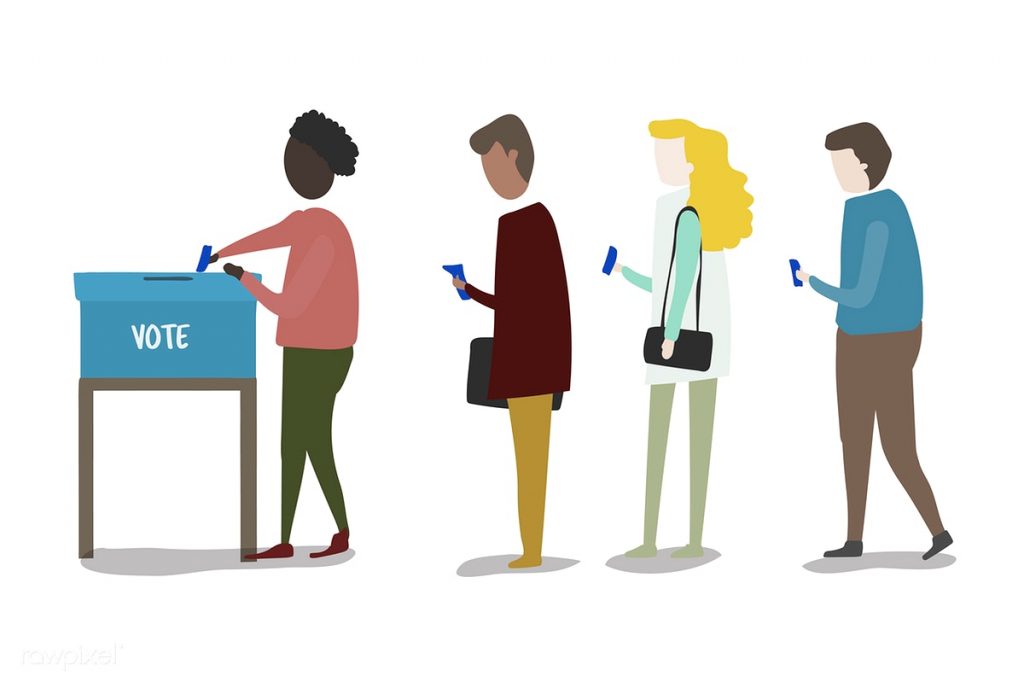Wie weit kann der Wahlerfolg rechter Parteien bei der Schweizer Nationalratswahl 2015 durch wirtschaftspolitische und kulturelle Präferenzen der Wählerschaft erklärt werden? Unsere Analyse zeigt, dass das Wahlergebnis wirtschaftspolitisch linke Präferenzen nur schlecht abbildet.
Die Schweizer Parlamentswahlen 2015 sind gekennzeichnet von einem sogenannten Rechtsrutsch: Während sowohl die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei (SVP), als auch die rechtsliberale FDP ihre Sitzanteile ausbauen konnten, verloren die fünf anderen Parlamentsparteien allesamt einen Teil ihrer Sitze im Nationalrat.
Ist dieses Wahlergebnis Ausdruck eines Rechtsrucks in den Präferenzen der Bevölkerung? Wenn man berücksichtigt, dass die Schweizerische Parteienlandschaft nicht allein durch eine wirtschaftspolitische Konfliktlinie, sondern zusätzlich auch durch eine kulturelle Konfliktlinie gekennzeichnet ist, ist die Beantwortung dieser Frage komplexer.
In einem eindimensionalen Politikraum würde man erwarten, dass das Wahlergebnis die Meinung der Medianwählerin bzw. des Medianwählers wiederspiegelt. Damit ist gemeint, dass die eine Hälfte der Wählerschaft weiter links und die andere Hälfte der Wählerschaft weiter rechts davon steht. Die Übertragung dieses berühmten Medianwählertheorems in den mehrdimensionalen Politikraum ist nicht trivial, denn das Ergebnis von Wahlen spiegelt nicht zwangsläufig die Meinung der Medianwählerin bzw. des Medianwählers auf den einzelnen Politikdimensionen wieder. Im Gegenteil, in solchen Räumen herrscht meist Chaos mit dementsprechend viel Spielraum für politische Veränderungen.
Stimmenanteil rechter Parteien spiegelt Wählerpräferenzen unzureichend wider
In unserer Analyen zeigen wir, dass der hohe Stimmenanteil rechter Parteien die Wählerpräferenzen bezüglich ökonomischer Policies nur unzureichend wiederspiegelt. Vielmehr ist der Wahlerfolg der Rechten die Konsequenz eines strukturellen Vorteils im zweidimensionalen Politikraum, der durch eine wirtschaftspolitische Politikdimension (diese betrifft den traditionellen Konflikt zwischen den Befürwortern einer Intervention des Staates in die Wirtschaft und den Anhängern einer liberalen Wirtschaftspolitk) und eine kulturelle Politikdimension (diese betrifft den Gegensatz libertärer und konservativer Politik) gekennzeichnet ist.
Dieser Vorteil entsteht, weil die Parteien nicht alle Winkel des Politikraums besetzen. Im Einklang mit bisheriger Forschung zum Schweizer Parteiensystem zeigt auch unsere Analyse, dass die Schweizer Parteien drei Bereiche des zweidimensionalen Raums besiedeln: Linke Parteien (SP und Grüne) lassen sich im wirtschaftlich linken und kulturell liberalen Bereich verorten. Wirtschaftlich moderate und rechte Parteien hingegen bieten eine grössere Bandbreite an kulturellen Policies an, da sie ihre jeweiligen Wirtschaftspolicies mit kulturell liberalen (FDP), moderaten (CVP) und konservativen (SVP) Policies kombinieren.
Der ökonomisch linke und kulturell konservative Bereich des Politikraums wird dementsprechend nicht von den Parteien bedient, obwohl sehr wohl eine Nachfrage nach entsprechenden Policy Packages bestehen würde, wie die Verteilung der Wähleridealpunkte in Abbildung 1 verdeutlicht.
Abbildung 1: Parteienkonfiguration im zweidimensionalen Politikraum
Wählerinnen und Wähler in diesem Bereich des Politikraums befinden sich in einer schwierigen Entscheidungssituation. Ihre wirtschaftspolitischen Präferenzen werden besser von linken Parteien repräsentiert, denen sie jedoch kulturell fern sind, während ihre kulturellen Präferenzen besser durch rechte Parteien vertreten wären, denen sie jedoch wirtschaftspolitisch fern stehen.
Wie ihre endgültige Wahlentscheidung aussieht hängt also stark davon ab, welches Gewicht sie der jeweiligen Policy-Dimension in ihrem Wahlkalkül beimessen. Überwiegen wirtschaftspolitische Themen, werden sie eher für eine linke Partei stimmen, haben kulturelle Policies ein stärkeres Gewicht, werden sie eher für eine rechte Partei stimmen
Unsere Ergebnisse zeigen weiter, dass diese Wählerinnen und Wähler erstens stärker dazu neigen, nicht zur Wahl zu gehen, und zweitens, dass sie, wenn sie zur Wahl gehen, eher für eine rechte Partei stimmen. Die höhere Wahrscheinlichkeit der Nichtwahl resultiert aus dem allgemein geringeren Nutzen, den eine Wahlentscheidung – für welche Partei auch immer – für diese Wählerinnen und Wähler bedeutet. Da keine Partei ihre kombinierten Interessen repräsentiert, müssen sie eine größere Diskrepanz zwischen ihren Interessen und den Parteipositionen auf zumindest einer Dimension in Kauf nehmen, wohingegen Wählerinnen in anderen Bereichen des Politikraums keine solchen Kompromisse eingehen müssen.
Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, steigt die Wahrscheinlichkeit der Nichtwahl zwar generell mit linken wirtschaftspolitischen Einstellungen und konservativen kulturellen Einstellungen, jedoch ist der Effekt deutlich verstärkt bei Wählerinnen und Wähler, die sowohl wirtschaftspolitisch links und kulturell konservativ eingestellt sind.
Abbildung 2: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit der Nichtwahl und der Wahl einer rechten Partei in Abhängigkeit der Wähleridealpunkte im zweidimensionalen Politikraum
Bewegen Sie die Grafiken mit der Maus, zoomen Sie mit dem Mausrad.
Nichtwahl
Wird die Grafik nicht korrekt angezeigt, klicken Sie bitte hier.
Wahl einer rechten Partei
Wird die Grafik nicht korrekt angezeigt, klicken Sie bitte hier.
Die Analyse der Wahlentscheidung derjenigen Befragten, die angeben, zur Wahl zu gehen, zeigt weiter, dass die Wahrscheinlichkeit, eine rechte Partei zu wählen, sowohl mit zunehmenden Konservativismus der Befragten, als auch mit rechteren wirtschaftspolitischen Präferenzen steigt, wie im zweiten Bild der Abbildung 2 zu sehen. Dabei zeigt sich ein größeres Gewicht der kulturellen als der wirtschaftspolitischen Präferenzen auf die Wahlentscheidung. Dies führt schlussendlich dazu, dass wirtschaftspolitisch linke und kulturell konservative Wählerinnen und Wähler den Entscheidungskonflikt häufiger zugunsten rechter Parteien lösen.
Man könnte meinen, dass dieses Phänomen dadurch ausgeglichen wird, dass wirtschafpolitisch rechte und kulturell liberal eingestellte Wählerinnen und Wähler ebenfalls dazu neigen, stärker ihren kulturellen Präferenzen zu folgen und linke Parteien zu wählen. Dies ist jedoch aus zwei Gründen nicht der Fall. Erstens bieten rechte Parteien eine größere Bandbreite an kulturellen Positionen an, so dass die Interessen des kulturell liberalen und wirtschaftspolitisch rechten Wählersegments trotzdem am besten von einer rechten Partei repräsentiert werden. Zweitens konnten wir in einem anderen Artikel, in welchem wir die Schweiz und vier andere europäische Länder vergleichend analysieren (Kurella und Rosset 2017), zeigen, dass linke Parteien kulturelle Fragen in ihren Wahlprogrammen weniger betonen und weniger erfolgreich darin sind, Wählerinnen und Wähler auf Basis ihrer kulturellen Positionen zu gewinnen.
In der Konsequenz haben linke Parteien Schwierigkeiten, einen großen Teil der wirtschaftspolitisch linken Wählerinnen und Wähler auf sich zu vereinigen, obwohl sie diesen wirtschaftspolitisch sehr nahe stehen. Rechte Parteien können hingegen mit der Unterstützung der wirtschaftspolitisch rechten Wählerinnen und Wähler rechnen, unabhängig von deren kulturellen Präferenzen. Zusätzlich erhalten sie die Unterstützung der wirtschaftspolitisch links eingestellten Wählerinnen und Wählern, die kulturell eher konservativ eingestellt sind. Dies hat bedeutenden Einfluss auf das Kräftegleichgewicht im Nationalrat und auf die parlamentarische Repräsentation der wirtschaftspolitischen Wählerpräferenzen.
| Nachwahlbefragung | Kandidatenbefragung | |
| Wirtschaftspolitische Themen |
|
|
| Kulturelle Themen |
|
|
Literatur:
- Kurella, Anna-Sophie und Jan Rosset (2017) “Blind spots in the party system: Spatial voting and issue salience if voters face scarce choices”, Electoral Studies, 49, 1-16.
Bild: rawpixel.com