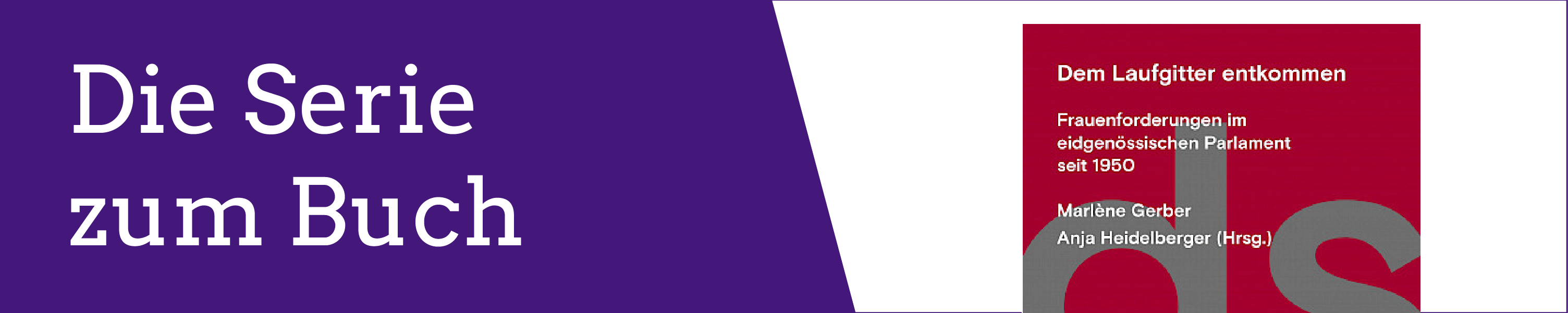Seit Einführung des Frauenstimmrechts kämpften (vor allem) Frauen konstant und intensiv für die Errichtung einer Mutterschaftsversicherung. Es gelang ihnen dabei, Druck auf Bundesrat und Parlament auszuüben. Aber die Stimmbevölkerung hiess erst beim sechsten Anlauf an der Urne eine Mutterschaftsversicherung gut. Wie lassen sich die häufigen Niederlagen der Einführung einer Mutterschaftsversicherung an der Urne erklären? Dem geht der folgende Artikel nach.
Im Dezember 1984 stimmte die Schweizer Stimmbevölkerung über eine Volksinitiative der Organisation für die Sache der Frau (Ofra) ab. Neben der Einführung eines mindestens 16-wöchigen Mutterschaftsurlaubs verlangte die Initiative für erwerbstätige Eltern einen bezahlten Elternurlaub von mindestens neun Monaten. Die Initiative erlitt damals ordentlich Schiffbruch und ging als Vorlage mit dem bisher zehntschlechtesten Abstimmungsresultat in die Geschichte der Schweizer Volksabstimmungen ein (15.8% Ja).
Konstanter Druck von Seiten der Frauen
Die Deutlichkeit dieses Volksverdikts soll nicht darüber hinwegtäuschen, wie bedeutend der Einfluss verschiedenster Frauen auf dem langen und steinigen Weg hin zu einer Mutterschaftsversicherung in der Schweiz war. Bereits lange vor Einführung des Frauenstimmrechts setzten sich linke und bürgerliche Frauenorganisationen für die Schaffung einer Mutterschaftsversicherung ein.
Seit Einführung des Frauenstimmrechts schufen Bundesrat und Parlament insgesamt vier Revisionsprojekte zur Errichtung einer Mutterschaftsversicherung. Dies gelang nicht zuletzt aufgrund Druck diverser parlamentarischer Vorstösse und zweier Volksinitiativen – eine davon die oben erwähnte. Bis auf das letzte dieser Projekte scheiterten sie aber allesamt und ebenso wie die Volksinitiativen an der Urne (siehe Infobox).
Wie auch schon bei der Erarbeitung der 1999 vors Volk kommenden Vorlage waren an der schlussendlich obsiegenden Variante Politikerinnen massgeblich beteiligt: Drei Parlamentarierinnen und ein Parlamentarier – Jacqueline Fehr (SP), Ursula Haller (SVP), Thérèse Meyer-Kälin (CVP) und Pierre Triponez (FDP) – erarbeiteten 2001 einen parteiübergreifenden Kompromissvorschlag in Form einer parlamentarischen Initiative. Dieser überzeugte mit der Lösung einer über die Erwerbsersatzordnung (EO) finanzierten Lohnausfallentschädigung 2004 zu guter Letzt auch die Stimmbevölkerung.
Die Stimmbevölkerung und die Wirtschaft als Vetospieler
Im Falle der Mutterschaftsversicherung agierte die Stimmbevölkerung also klar als Bremse. Was waren Gründe für die wiederholte Ablehnung an der Urne?
Zum einen erfuhr die Mutterschaftsversicherung sehr lange konstanten Widerstand von Seiten der Wirtschaft, die prominent vor hohen Mehrkosten warnte und auf bestehende Lösungen (siehe Infobox) verwies. Mit zunehmender Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt gewann die Frage nach einer finanzierbaren und für die Wirtschaft verträglichen Mutterschaftsversicherung schliesslich an Bedeutung. Eher langsam setzte sich schliesslich die Überzeugung durch, dass eine Mutterschaftsversicherung die Wirtschaft im Schnitt gar finanziell entlasten könnte.
Das mehrfache Nein der Stimmbevölkerung ist sicherlich auch als Ausdruck der starken Verankerung des traditionellen Familienbildes in der Schweiz zu verstehen. Die erwerbstätige Mutter passte nicht ins Bild, respektive sie wurde geduldet, aber nicht als unterstützungswürdig betrachtet.
Hier schliesst auch die Beobachtung an, dass die CVP im Parlament die Mutterschaftsversicherung zwar stets unterstützte oder gar vorantrieb, jedoch im Unterschied zu den linken Parteien eher zum Schutze der Familie (und in frühen Jahren auch zur Verhinderung von Schwangerschaftsabbrüchen aus finanziellen Engpässen) und nicht in erster Linie zum Schutze der erwerbstätigen Frau. Bis und mit 1999 lehnte die Anhängerschaft der CVP eine Mutterschaftsversicherung an der Urne mehrheitlich ab, obwohl die Projekte jeweils auch Leistungen für nichterwerbstätige Mütter beinhaltet hatten. Sympathisant:innen der SVP lehnten die Mutterschaftsversicherung gar bis zuletzt ab.
Von der Maximalforderung zur Minimalvariante
Ein weiterer Grund für die schwache Unterstützung der Revisionen an der Urne liegt ebenfalls darin, dass die Reformprojekte oftmals zu viele Angriffsflächen boten. So etwa war die Einführung der Mutterschaftsversicherung lange in ebenfalls umstrittene Krankenversicherungsrevisionen eingebaut worden. Die 1999 abgelehnte Variante hätte etwa zusätzlich einen vierwöchigen Adoptionsurlaub beinhaltet, was das Referendumskomitee als «unnötigen Luxus» bezeichnete. Als kompromissfähig erwies sich letztlich nur eine abgespeckte Minimalvariante für erwerbstätige Mütter mit einem Zückerchen für die Männer: Mit Annahme der Vorlage war die Grundentschädigung für Armeedienstleistende auf 80 Prozent angehoben worden.
Mit einem Lohnersatzanspruch von 80 Prozent während einer Dauer von 14 Wochen – bis 2020 ohne ergänzenden Eltern- oder Vaterschaftsurlaub – bewegt sich die Schweiz im europäischen Vergleich bezüglich der Grosszügigkeit der Leistungen bei Mutterschaft am unteren Rand. Dass seither nicht verstärkt versucht worden war, die Leistungen auszubauen, mag damit zu tun haben, dass der bezahlte Mutterschaftsurlaub den Frauen zwar den notwendigen Schutz bietet, dass er sich mit zunehmender Dauer ohne entsprechende Urlaubsmöglichkeiten für den Partner für deren Integration in den Arbeitsmarkt eher als hinderlich erweist. In dem Sinne war die Verknüpfung des Mutterschafts- mit dem Elternurlaub in der Ofra-Initiative nur konsequent hinsichtlich Erfüllung des Ziels einer ausgewogeneren Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern, sowohl in der Familie als auch im Erwerbsleben.
Referenz:
- Gerber, Marlène (2021). Die Geschichte einer Zangengeburt: die Mutterschaftsversicherung. In Dem Laufgitter entkommen: Frauenforderungen im eidgenössischen Parlament seit 1950, hg. Marlène Gerber & Anja Heidelberger (313–43). Zürich, Genf: Seismo Verlag.
Bild: Sozialarchiv
Mit der Schaffung des eidgenössischen Fabrikgesetzes 1877 verhängte der Gesetzgeber für Mütter ein achtwöchiges Arbeitsverbot nach der Geburt, entschädigte sie aber nicht für den damit einhergehenden Einkommensverlust.
Mit dem Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (1918) erhielten Frauen die Möglichkeit, eine freiwillige Taggeldversicherung abzuschliessen. Diese konnte den Erwerbsausfall zwar mindern, aber nicht kompensieren (und längst nicht alle konnten sich diese leisten).
1945 schuf die (männliche) Stimmbevölkerung mit 76.3% Ja-Stimmen den Verfassungsauftrag zur Errichtung einer Mutterschaftsversicherung.
Ab 1972 sah das Obligationenrecht vor, dass Arbeitgebende zu einer Lohnfortzahlungspflicht bei einem Arbeitsausfall wegen Schwangerschaft oder Niederkunft verpflichtet sind. Die Dauer der Lohnfortzahlungspflicht war jedoch abhängig von derjenigen des Anstellungsverhältnisses.
Die von der SP und dem Gewerkschaftsbund lancierte Volksinitiative «für eine soziale Krankenversicherung» sowie ein Gegenentwurf, die einen bezahlten Mutterschaftsurlaub mittels Krankenversicherungsrevision einführen wollten, scheiterten 1974 an der Urne.
1984 scheiterte die Volksinitiative «für einen wirksamen Schutz der Mutterschaft» (Ofra-Initiative; siehe oben – 15.8% Ja).
1987 lehnte die Stimmbevölkerung trotz Unterstützung aller Bundesratsparteien eine Krankenversicherungsrevision ab, die die Schaffung einer Mutterschaftsversicherung beinhaltet hätte (28.7%). Das Referendum ergriffen Akteure aus dem Gesundheitswesen und der Gewerbeverband.
1999 ergriff die Junge SVP, unterstützt von den Präsidenten des Arbeitgeberverbands und des Gewerbeverbands, das Referendum gegen ein neu geschaffenes Bundesgesetz über die Mutterschaftsversicherung. Der Ja-Anteil an der Volksabstimmung betrug 39.0%.
55.5% der Stimmenden befürworteten 2004 eine Änderung der Erwerbsersatzordnung, die knapp 60 Jahre nach dem Verfassungsauftrag die Einführung der Mutterschaftsversicherung ermöglichte. Das Referendum gegen die Vorlage ergriff die SVP.