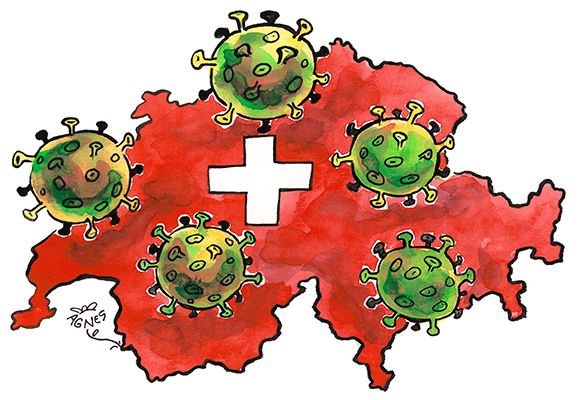Mit der Lockerung der Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie erhalten die Kantone wichtige Entscheidungskompetenzen zurück, welche der Bund gestützt auf das Epidemiengesetz übernommen hatte. Nun steht die Befürchtung im Raum, dass ein Flickenteppich an Regelungen entsteht. Basierend auf unserer Forschung zeigen wir in einem Vergleich mit Deutschland, dass Einheitlichkeit jedoch nicht nur durch Zentralisierung beim Bund, sondern auch durch Koordination erreicht werden kann.
Eine Diskussion um die Leistungsfähigkeit des Föderalismus als Form der Staatsorganisation wurde schon lange nicht mehr so offensichtlich geführt wie in der aktuellen Covid-19-Pandemie. In den Schweizer Zeitungen las man vom «Stresstest für den Föderalismus». In der Berichterstattung ging es häufig darum, dass der Bundesrat durch die Ausrufung der ‘ausserordentlichen Lage’ weitgehende Kompetenzen zum Erlass von Massnahmen zur Eindämmung des Virus hatte und dadurch in Bereichen agierte, die eigentlich im Kompetenzbereich der Kantone liegen.
Verfechter einer solchen Zentralisierung finden, der «Kantönligeist ist hier fehl am Platz» und warnen vor einem «Flickenteppich» beispielsweise im Bildungsbereich. Sie argumentieren, dass die Krise die ganze Schweiz betrifft und somit einheitliche und rasche Lösungen nötig sind, welche besser von einer zentralen Instanz wie dem Bundesrat getroffen werden können. Insbesondere als es um die Lockerung der Massnahmen ging, wurden allerdings Stimmen laut, die mehr Kompetenzen für die Kantone fordern. Dies zeigt sich anhand von Überschriften wie «Mehr Föderalismus bei den Lockerungsmassnahmen wagen» und «Schlägt jetzt die Stunde der Kantone?». Mit dem Ende der ‘ausserordentlichen Lage’ am 19. Juni 2020 hat der Bundesrat sogar beschlossen, dass bei einem Wiederanstieg der Covid-19-Fallzahlen Entscheidungen über Massnahmen primär von den Kantonen getroffen werden sollen. Hier wird also der Vorteil des Föderalismus, regionale oder lokale Lösungen für unterschiedliche Infektionslagen zu ermöglichen, in den Vordergrund gestellt. Wenn die Entscheidung über die Massnahmen zur Viruseindämmung im Verantwortungsbereich der Kantone liegt, können diese an das lokale Infektionsgeschehen angepasst werden. Allerdings wird oft befürchtet, dass eine solche Dezentralisierung zu Lasten der Einheitlichkeit geht. Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine stärkere Rolle der Kantone im Umgang mit Pandemien tatsächlich zum befürchteten «Flickenteppich» führen würde.
In Deutschland findet eine ähnliche Debatte über den Föderalismus statt. Im Gegensatz zur Schweiz lag die Verantwortung für den Erlass eines Grossteils der Massnahmen zur Eindämmung von Covid-19 allerdings in der Verantwortung der Bundesländer. Auch hier wurde vor einem «Flickenteppich» gewarnt. Selbst einzelne Ministerpräsidenten*innen (Regierungschef*innen der Länder) forderten eine Zentralisierung des Infektionsschutzes in Krisenzeiten. Um herauszufinden ob und in welchem Ausmass dezentrale Entscheidungen über Massnahmen tatsächlich zu weniger Einheitlichkeit führen, lohnt also ein Blick nach Deutschland. Was kann die Eidgenossenschaft vom grossen Nachbarn lernen?
Einheitlichkeit durch Zentralisierung: Krisenmanagement in der Schweiz
Die Schweiz ist eigentlich für ihr dezentrales föderales System bekannt. Die Kantone nehmen im Schweizer Föderalismus eine wichtige Rolle ein. Sie haben weitreichende Kompetenzen, beispielsweise in den Politikfeldern Gesundheit, Bildung und Polizei und Justiz, haben eigene Steuerbefugnisse und nehmen an der Willensbildung des Bundes teil (Vatter 2016). Im Pandemie-Fall findet allerdings eine Zentralisierung statt, die den Bundesrat zum Hauptverantwortlichen und die Kantone zu Nebendarstellern macht. Das Epidemiengesetz (EpG), welches 2012 im Parlament verabschiedet und 2013 vom Volk angenommen wurde, definiert in Artikel 6 eine ‘besondere Lage’, die es dem Bundesrat gestattet, Massnahmen zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten zu erlassen. Das Gesetz legt aber fest, dass der Bundesrat die Kantone anhören muss.
Die Schweiz befand sich vom 28. Februar bis zum 15. März 2020 in solch einer ‘besonderen Lage’. Am 16. März 2020 wurde, gestützt auf Artikel 7 EpG, jedoch die ‘ausserordentliche Lage’ festgestellt, in welcher die Anhörungspflicht der Kantone entfällt. Diese dauerte bis zum 19. Juni 2020 an. Der Bundesrat war direkt ermächtigt, «für das ganze Land oder für einzelne Landesteile die notwendigen Massnahmen anzuordnen». Dies umfasst beispielsweise Veranstaltungs- und Versammlungsverbote, Verbot von Präsenzunterricht in Bildungseinrichtungen oder Schliessungen von Läden, Restaurants und Freizeiteinrichtungen. Die Anordnung von Massnahmen geschah per Verordnung des Bundesrates (COVID-19-Verordnung) und führte zu einer grossen Einheitlichkeit. Im ganzen Land (bis auf wenige Ausnahmen) galten zur selben Zeit dieselben Regelungen.
Die auf Bundesebene beschlossenen Massnahmen wurden von den Kantonen vollzogen. Wiederholt stellte der Bundesrat fest, dass die Kantone jedoch keine Regelungen erlassen durften, die über die Bundesverordnung hinaus gehen, wie beispielswiese das Kippen des Ausgehverbots für Seniorinnen und Senioren im Kanton Uri zeigt. Einzig gestützt auf Artikel 7e der COVID-19-Verordnung kann der Bundesrat einzelne Kantone auf Antrag zum Erlass einzelner weitergehender Massnahmen ermächtigen. Dies geschah jedoch nur einmal im Kanton Tessin bezüglich der Schliessung von Baustellen und Industrieanlagen.
Einheitlichkeit durch Koordination: Krisenmanagement in Deutschland
In Deutschland hingegen lag und liegt die Entscheidung über die Einführung von Massnahmen (wie beispielsweise Veranstaltungs- und Versammlungsverbote, Verbot von Präsenzunterricht in Bildungseinrichtungen oder Schliessungen von Läden, Restaurants und Freizeiteinrichtungen) laut Infektionsschutzgesetz (IfSG) im Verantwortungsbereich der Länder. Dies hat dazu geführt, dass alle Länder ihre eigenen Verordnungen zum Umgang mit dem Covid-19-Virus erlassen haben.
Es ist also in Deutschland theoretisch möglich, dass die 16 Länder unterschiedliche Massnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlicher Tragweite erlassen. Interessanterweise ist dies jedoch nur in einem eingeschränkten Masse tatsächlich geschehen. Zwar wurden die einzelnen Massnahmen nicht überall zum exakt gleichen Zeitpunkt beschlossen, aber im Grossen und Ganzen zeigt sich doch ein sehr ähnliches Vorgehen. Dies kann grösstenteils auf die regelmässigen Absprachen zwischen der Bundesregierung bzw. der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsident*innen der Länder zurückgeführt werden. Diese fanden zunächst wöchentlich, später zweiwöchentlich statt. Auf diesen Treffen wurden die wesentlichen Massnahmen, deren Umfang sowie Zeitplan abgesprochen und Vereinbarungen geschlossen. Die Ergebnisse dieser Treffen wurden in Pressekonferenzen und Pressemeldungen der Öffentlichkeit mitgeteilt. Diese Öffentlichkeit hat vermutlich auch dazu beigetragen, dass sich die Länder grösstenteils an die Absprachen gehalten haben. Es gab zwar einzelne Länder, die regelmässig von den Vereinbarungen abgewichen sind, meist waren diese Abweichungen aber vergleichbar gering. Den Flickenteppich gab es also, jedoch unterschieden sich die Flicken nicht so stark voneinander, wie manchmal befürchtet worden war.
Mitte Mai, als die Phase der Lockerung der Massnahmen eingeleitet wurde, konnten sich die Regierungschefinnen und -chefs des Bundes und der Länder in Deutschland allerdings nicht mehr auf einen gemeinsamen Fahrplan verständigen. Die Länder trafen wieder mehr eigene Entscheidungen. Eine Einigung kam nur darüber zustande, dass die Länder «in eigener Verantwortung» Öffnungsschritte verordnen würden. Gemeinsam beschlossen wurde auch ein Notfallmechanismus zur Eindämmung lokaler Ausbrüche. Trotz der Einigung auf ein eigenständiges Vorgehen der Länder sind deren Fahrpläne jedoch immer noch vergleichsweise ähnlich.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass Einführung von Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in beiden Ländern von grosser Einheitlichkeit geprägt war. Während dies in der Schweiz mit der starken Konzentration der Kompetenzen auf Bundesebene zusammenhängt, haben enge Absprachen in Deutschland zu einem weitgehend einheitlichen Vorgehen geführt.
Einheitlichkeit durch Zentralisierung oder Koordination?
Dass Einheitlichkeit nicht nur durch Zentralisierung möglich ist, sondern auch durch Koordination erreicht werden kann, lässt sich am Beispiel der Bildungspolitik zeigen.
In der Schweiz hat der Bundesrat am 13. März 2020 den Präsenzunterricht an Schulen, Hochschulen und Ausbildungsstätten untersagt. Dies führt dazu, dass ab Montag, 16. März 2020 alle Schulen und Hochschulen im gesamten Land zum selben Zeitpunkt Präsenzveranstaltungen einstellten, Abweichungen der Kantone oder Gemeinden waren nicht möglich. Zwei Monate später, ab dem 11. Mai, erlaubte der Bundesrat die Wiederaufnahme des Bildungsbetriebs. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erarbeitete gemeinsam mit der Schweizer Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) Schutzkonzepte. Kantone und Gemeinden waren für deren Umsetzung zuständig. Umstritten war insbesondere die Frage der Maturitätsprüfungen. Der Bundesrat entschied: «kantonale Gymnasien können dieses Jahr auch auf die schriftlichen Maturitätsprüfungen verzichten, nachdem die EDK bereits beschlossen hatte, die mündlichen Prüfungen nicht durchzuführen». An dieser Stelle überliess der Bundesrat explizit den Kantonen die Entscheidung. In der Folge nutzten die Kantone diese Entscheidungsfreiheit. Dies führte dazu, dass in einigen Kantonen Maturitätsprüfungen abgehalten wurden, in anderen nicht. Hier führte also eine dezentrale Entscheidungskompetenz zu weniger Einheitlichkeit. Ein Flickenteppich entstand.
In Deutschland gab es zu Beginn der Krise einige Tage der Unsicherheit bezüglich der Präsenzveranstaltungen an Schulen. Mitte März kam bei einem Treffen der Bundesregierung und der Landesregierungen keine Einigung bezüglich der Schliessung von Schulen zustande. Daraufhin haben wenige Tage später einzelne Länder eigenständig entschieden die Schulen zu schliessen. Als erstes Land beendete das Saarland den Präsenzunterricht, was mit der Nähe zum stärker von Covid-19 betroffenen Frankreich begründet wurde. Dem Saarland folgten weitere Länder, bis schliesslich im ganzen Land die Schulen geschlossen wurden – dies, obwohl der Bund einem solchen Schritt damals noch kritisch gegenüberstand. Die Schliessung erfolgte, im Gegensatz zur Schweiz, also nicht zum selben Zeitpunkt in allen Ländern. Es zeigt sich jedoch, dass einzelne Länder Druck auf die anderen Länder ausübten, ähnliche Entscheidungen zu treffen.
Bezüglich der Abiturprüfungen (Maturitätsprüfungen in Deutschland) stellte sich die Frage, ob und wie diese durchgeführt werden sollten. Ähnlich der Kantone in der Schweiz, hatten auch die Länder in Deutschland die Möglichkeit, diese Entscheidung eigenständig zu treffen und die Frage unterschiedlich zu regeln. Allerdings gelang es hier schlussendlich im Rahmen der Konferenz der Kultusministerinnen und -minister der Länder (KMK) eine einheitliche Regelung aller Länder zu finden. Es wurde festgelegt, dass die Abiturprüfungen in allen Ländern durchgeführt werden, allerdings zum Teil erst später als ursprünglich geplant.
In einer Situation, in der sowohl die Kantone als auch die Länder die Möglichkeit hatten selbst zu entscheiden, wie beispielsweise in der Frage der Maturitätsprüfungen, tendierten die Kantone eher dazu eigenständig zu handeln und nahmen unterschiedliche Regelungen in Kauf. In Deutschland ist dagegen die Tendenz zur Koordination und zur einheitlichen Regelung, selbst wenn die Länder allein entscheiden könnten, vergleichsweise stärker ausgeprägt. Das Beispiel Deutschland zeigt allerdings auch, dass mehr Handlungsspielraum der Kantone nicht unbedingt zu einem «Flickenteppich» führen muss oder nur das Handeln des Bundes zu einheitlichen Massnahmen führt. Durch eine intensive Nutzung interkantonaler Gremien wie der Direktorenkonferenzen kann Einheitlichkeit auf anderem Wege erreicht werden – so sie denn gewünscht ist.
Abschliessend lässt sich also festhalten, dass die Möglichkeit zu regionalen oder lokalen Entscheiden einer der grössten Vorteile des Föderalismus ist. Als Nachteil wird immer wieder angeführt, dass Föderalstaaten demgegenüber grössere Probleme haben, einheitliche Regelungen im gesamten Staatsgebiet zu erreichen. Meist wird argumentiert, dass nur eine Zentralisierung der Entscheidungskompetenz beim Bund einheitliche Regelungen hervorbringen kann.
Unsere Analyse verdeutlicht zwar, dass Föderalstaaten mit dezentralen Entscheiden eine grössere Akzeptanz für Unterschiede aufbringen müssen. Sie zeigt allerdings auch, dass Einheitlichkeit nicht nur durch Zentralisierung beim Bund erreicht werden kann. Ein etabliertes und funktionierendes System von intergouvernementalen (interkantonalen) Gremien kann auch dazu genutzt werden, Einheitlichkeit trotz dezentraler Entscheidungskompetenzen herzustellen. Sowohl Deutschland mit seinen Ministerkonferenzen (Hegele und Behnke 2017) als auch die Schweiz mit den Direktorenkonferenzen (Schnabel und Mueller 2017) sind also grundsätzlich gut aufgestellt, um einen Flickenteppich zu vermeiden und Einheitlichkeit durch Koordination herzustellen.
Referenzen:
- Hegele, Yvonne, und Nathalie Behnke. 2017. „Horizontal coordination in cooperative federalism: The purpose of ministerial conferences in Germany“. Regional & Federal Studies 27 (5): 529–48. https://doi.org/10.1080/13597566.2017.1315716.
- Schnabel, Johanna, und Sean Mueller. 2017. „Vertical influence or horizontal coordination? The purpose of intergovernmental councils in Switzerland“. Regional & Federal Studies 27 (5): 549–72. https://doi.org/10.1080/13597566.2017.1368017.
- Vatter, Adrian. 2016. Das politische System der Schweiz. 2. Aktualisierte Auflage. Nomos: Baden-Baden.
Bild: live-karikaturen.ch