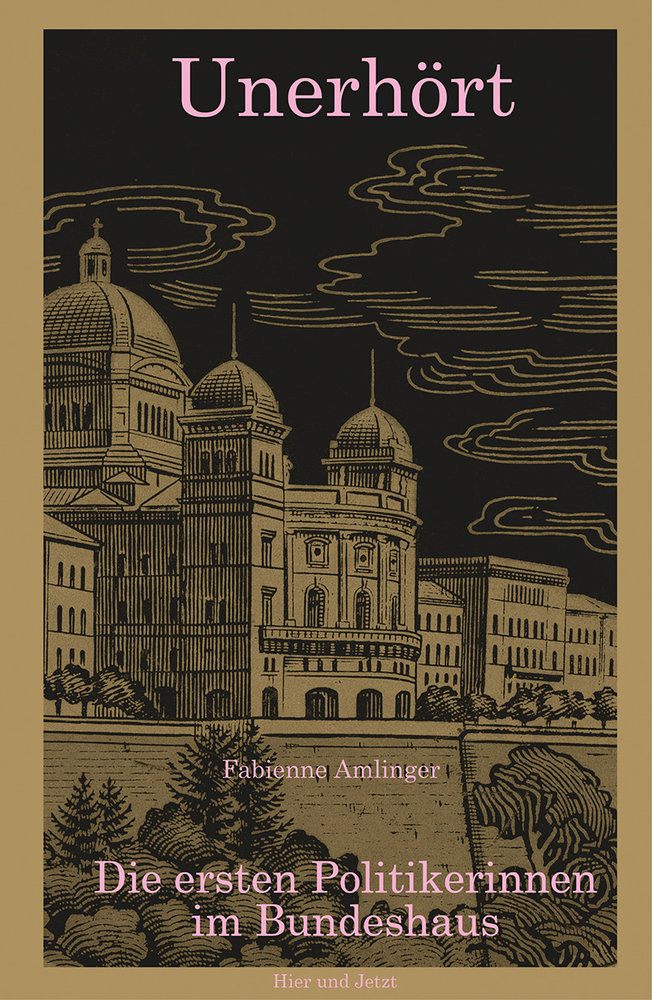Im neusten Werk der Berner Historikerin und Geschlechterforscherin Fabienne Amlinger richten sich die Scheinwerfer auf die Jahre der ersten Politikerinnen im Bundeshaus. Das umfassende Buch begnügt sich dabei nicht mit Einzelportraits, sondern analysiert die Situation und die Ereignisse in der Schweizer Politik an der Schwelle vom jahrhundertealten Ausschluss zum schrittweisen Platznehmen der Frauen in der Schweizer Politik.
Diesen Übergang beleuchtet Fabienne Amlinger in fünf Essays unter verschiedenen Aspekten wie beispielsweise dem Gelächter an Ratssitzungen, der Architektur des Bundeshauses oder den Dramen rund um Bundesratswahlen. Jedem Essay folgt – auf der Basis eines längeren Gesprächs – das Portrait einer frühen Nationalrätin.
«Achtzig Sekunden»
Der erste Essay trägt die Überschrift «Achtzig Sekunden» – solange dauerte im November 1971 der Beitrag der «Filmwochenschau» über die ersten Frauen im Bundesparlament (die Filmwochenschau wurde damals jeweils im Vorprogramm der Kinos ausgestrahlt). Fabienne Amlinger zeigt die elf Nationalrätinnen und Lise Girardin, die Ständerätin aus Genf, in ihrer ganzen Vielfalt, ergänzt mit viel Hintergrundinformationen. Sie macht dies, indem sie den Anfangsmoment der ersten Parlamentssitzung aus der Sicht jeder einzelnen Parlamentarierin schildert. Damit werden die persönlichen Sichtweisen der Pionierinnen und ihre Herausforderungen im männerdominierten Bundeshaus sichtbar.
Mit diesem Einstieg zeigt die Autorin, dass sie nicht eine abstrakte Forscherin ist. Sie arbeitet zwar seit fast zwei Jahrzehnten als Wissenschaftlerin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung an der Universität Bern. Sie ist aber auch bekannt für ihre Vermittlungsarbeit, am Gosteli-Archiv, als Kuratorin der vielbeachteten Ausstellung «Frauen ins Bundeshaus! 50 Jahre Frauenstimmrecht» im Historischen Museum Bern oder als dramaturgische Mitarbeiterin im Bereich Tanz & Performing in der Dampfzentrale Bern.
Fünf Einzelportraits
Von den 1971 ins Bundesparlament gewählten Frauen leben nur noch zwei. Dies dürfte der Grund dafür sein, dass die Autorin auch Frauen portraitierte, die etwas später ins Parlament gewählt wurden, so namentlich die Zürcher Grüne Monika Stocker (1987–1991), die Bernerin Elisabeth Zölch, SVP (1987–1994) und die Zürcherin Rosmarie Zapfl, CVP (1995–2006).
Die einzige portraitierte Vertreterin der ersten Generation ist Gabrielle Nanchen, SP-Nationalrätin aus dem Wallis (1971–1979). Diese äussert sich erfrischend klar und frei von Versuchen, zu beschönigen oder zu glätten. Als linke Frau hatte sie im konservativen Wallis einen schweren Stand; die ganzen acht Jahre wurde sie von der französischen Walliser Presse ignoriert. Als Nanchen ihr drittes Kind bekam, beendete sie ihre politische Karriere. Nachher hatte sie Mühe, im Wallis eine Erwerbsarbeit zu finden.
Innerparteiliche Machtmechanismen zeigt das Portrait der Zürcher Freisinnigen Lili Nabholz auf, welche zu den Vorreiterinnen der bürgerlichen Gleichstellungspolitik in der Schweiz zählt. Sie hatte das Präsidium für die Organisation des 4. Schweizerischen Frauenkongresses inne (1975), präsidierte in den 1980er Jahren die Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen und spielte im Nationalrat, in den sie 1987 gewählt wurde, eine wichtige Rolle beim Vorantreiben von Frauenanliegen.
Bei der parlamentarischen Beratung des Gleichstellungsgesetzes brachte Lili Nabholz erfolgreich die Umkehr der Beweislast bei Lohngleichheitsklagen durch. Nach Reklamationen des Vertreters der Arbeitgeberseite beim Fraktionschef wurde Nabholz abgestraft, indem man ihr den Lead wegnahm; an ihrer Stelle vertrat nun der FDP-Fraktionschef das Geschäft. Als es jedoch im Fall Elisabeth Kopp um die Aufhebung der Immunität der ersten Bundesrätin ging, hielten sich der Partei- und der Fraktionspräsident zurück und liessen Lili Nabholz die FDP-Fraktion vertreten. Auch wenn sie das Verhalten von Elisabeth Kopp als falsch erachtete, fiel es ihr schwer, als Frau für die Aufhebung der Immunität der ersten Bundesrätin zu votieren.
Misogyne Heiterkeit
Heiterkeit kommt im Bundesparlament gelegentlich auf; dies wird im Parlamentsprotokoll jeweils entsprechend vermerkt, wobei zwischen «Heiterkeit» und «Grosse Heiterkeit» unterschieden wird. In ihrem Essay stellt Fabienne Amlinger fest, dass Heiterkeitsvermerke überdurchschnittlich häufig im Zusammenhang mit Frauen vorkommen, wobei sie zwei Konjunkturen unterscheidet. Die erste Konjunktur startete Ende der 1950er Jahre, als die Forderung nach dem Frauenstimmrecht erstmals richtig auf die politische Agenda kam: Da trat «die Heiterkeit als treue Begleiterin» auf. Wer gewisse Voten in den entsprechenden Parlamentsdebatten liest, wird nicht darum herumkommen, sich fremdzuschämen. Für Fabienne Amlinger ist dieser Humor weit entfernt von kultiviertem Humor oder feinsinnigem Witz. Es sind vielmehr ungehobelte und plumpe, auch verletzende Äusserungen. Peter von Roten, einer der wenigen Frauenstimmrechtsbefürworter im Nationalrat jener Zeit, nannte sie denn auch in seinem Votum treffend «leichtes Gewieher».
Die zweite Konjunktur der «Heiterkeits»-Vermerke setzte nach der Einführung des Frauenstimmrechts ein und richtete sich meistens gegen die anwesenden, gewählten Parlamentarierinnen. Bestandteil dieses Humors war häufig die weibliche Sexualität. Für Fabienne Amlinger verbirgt sich hinter dieser «Heiterkeit», hinter dem Lachen über Frauen ein Gefühl der männlichen Überlegenheit, teilweise auch getarnte Feindseligkeit. Die Autorin schliesst in ihrem Essay auch die Mitlacher im Parlament mit ein, die sie als «Komplizen der misogynen Heiterkeit» bezeichnet.
«Ins Haus!»
Im dritten Essay widmet sich Fabienne Amlinger auf originelle Art dem Bundeshaus, welches Mitte des 19. Jahrhunderts von Männern für Männer gebaut wurde und in dem die Frauen nun Schritt um Schritt Platz nahmen. Beim Bau des Bundeshauses war sehr auf die regionale und kulturelle Diversität der Schweiz geachtet worden. Nicht jedoch auf die Frauen; diese blieben, wie selbstverständlich, ausgeschlossen. Es gab sie im Gebäude real als Ehefrau eines Bundesrates, als Reinigungskraft, als Stenografin – oder als Allegorie für Wahrheit und Weisheit, für Gerechtigkeit und Patriotismus.
Mit den neu gewählten Parlamentarierinnen stellten sich im Bundeshaus auch räumliche Herausforderungen wie etwa die Toilettenfrage, welche lange nicht befriedigend gelöst blieben. Die Frauen veränderten das Bundeshaus aber auch in dem Sinn, dass sie mehr Farbe reinbrachten. Die Berner POCH-Grüne Vertreterin Barbara Gurtner tat dies in den Augen des Rates zu intensiv, weshalb sie wegen ihres Kleidungsstils gerügt werden sollte. Die in dieser Angelegenheit mandatierte Schwyzer CVP-Nationalrätin Elisabeth Blunschy machte dies – frauensolidarisch – auf ihre Weise.
Betrat Fabienne Amlinger mit dem Essay über das Bundeshaus thematisch Neuland, so ist dies beim vierten Essay über die Bundesratswahlen («Drama») weniger der Fall. Sie zeigt bei diesen Wahlen, wie mit harten Bandagen gekämpft wurde, wenn Frauen machtvolle Positionen anstrebten. Angefangen bei Lilian Uchtenhagen, die 1983 von Otto Stich (auch mit Unterstützung von einigen Gewerkschaftern) ausgebremst wurde, über das wohl bekannteste Drama der Nichtwahl von Christiane Brunner von 1993 bis zur Abwahl von Ruth Metzler zehn Jahre später, die für die Wahl von Christoph Blocher in den Bundesrat geopfert wurde. Detailliert geschildert wird auch der Fall der ersten Bundesrätin Elisabeth Kopp, die letztlich über ihren Mann stolperte, sowie die Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf, SVP-Mitglied und Bündner Finanzdirektorin, die 2007 als Kandidatin mithalf, Christoph Blocher als Bundesrat abzuwählen.
«Unerhört»
Der letzte, facettenreiche Essay trägt denselben Titel wie das Buch. «Unerhört!» war es nach patriarchaler Logik, dass Frauen, für die im Bundeshaus kein Platz vorgesehen war, nun dort sukzessive Einsitz nahmen. Unerhört und über Jahrzehnte nicht gehört waren die Frauenanliegen, welche erst diese Politikerinnen, meist überparteilich, hartnäckig und schliesslich mit Erfolg in das Parlament trugen: Gleichstellung, Mutterschaftsversicherung, straffreier Schwangerschaftsabbruch (bei letzterer Forderung waren sie allerdings nicht geschlossen). «Unerhört!» war aber auch der heftige Widerstand und der Sexismus, den Frauen unter der Bundeskuppel erlebten.
Mit ihrer jüngsten Publikation legt Fabienne Amlinger eine verständlich und spannend geschriebene Studie über die Zeit der ersten Politikerinnen im Bundeshaus vor. Sie will damit dazu beitragen, dass diese Pionierinnen mit ihren Erfahrungen im politischen Zentrum der Macht sichtbar werden und nicht in Vergessenheit geraten. Das ist ihr gelungen. Ein grosser Mehrwert dieser Studie liegt auch darin, dass Fabienne Amlinger die politische Praxis dieser Pionierinnen in einen grösseren Zusammenhang stellt: den Übergang von der reinen Männerdemokratie zur schrittweisen Verstärkung der Einmischung und Mitsprache der Frauen, mit allen Widerwärtigkeiten, die den ersten Politikerinnen widerfahren sind und denen sie Stand gehalten haben.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13. August im Journal21 erstpubliziert.
Referenz
- Amlinger, Fabienne (2025): Unerhört. Die ersten Politikerinnen im Bundeshaus. Zürich: Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte. Zürich 2025, 238 Seiten.