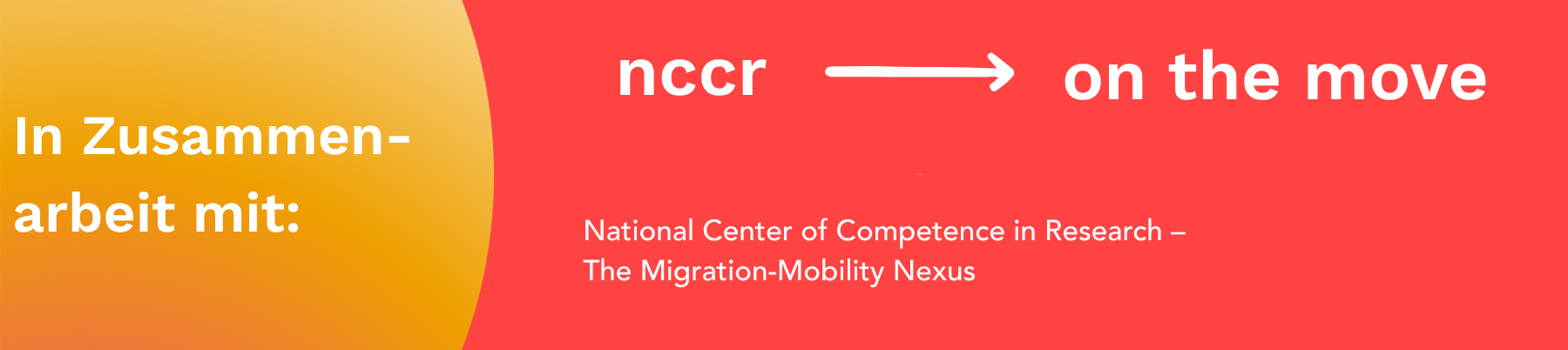Integrationsdispensation: warum für Migrant*innen strengere soziale Normen gelten
Philipp Lutz, Stefan Manser-Egli
17th November 2025

Soziale Normen und Erwartungen prägen zwar unser Leben, gelten jedoch nicht für alle gleichermaßen. Eine neue Studie zeigt, dass für Migrant*innen in der Schweiz strengere Normen gelten als für den Rest der Gesellschaft, beispielsweise in Bezug auf lokales soziales Engagement und die Einhaltung der Rechtsordnung. Dieser Doppelstandard bestätigt, was die Migrationsforschung immer wieder betont: Nur von einigen Menschen wird Integration erwartet, während andere nicht denselben Erwartungen unterliegen.
„Hanna trifft Sue. Sue fragt: ‚Möchtest du mal auf einen Kaffee vorbeikommen?‘ Was ist das Beste, was Hanna tun kann? (a) einen geeigneten Termin mit Sue vereinbaren, um auf einen Kaffee vorbeizukommen; (b) vorbeikommen, wann immer Hanna Zeit hat; oder (c) warten, bis Sue Hanna erneut einlädt, vorbeizukommen.” (Orgad 2015)
Vielleicht kennen Sie die richtige Antwort auf diese Frage, die bis vor kurzem Teil der niederländischen Staatsbürgerschaftsprüfung war. Vielleicht auch nicht. Und vielleicht müssen Sie sie auch gar nicht kennen. Gebürtige Staatsbürger*innen sind von Staatsbürgerschaftsprüfungen und in der Regel auch von Integrationserwartungen, wie sie in dieser Frage zum Ausdruck kommen, ausgenommen. Sie sind in gewisser Weise von der Integration befreit (Schinkel 2018) – eine Kritik, die in Debatten über die Integration von Migrant*innen eine zentrale Rolle spielt. Aber was bedeutet das in der Praxis? Sind Migrant*innen strengeren sozialen Normen unterworfen als Staatsbürger*innen?
Der Migrationsbias in sozialen Normen
In einer aktuellen Studie haben wir diese Idee erstmals empirisch überprüft (Manser-Egli und Lutz 2025). Wir fragten: Werden an Migrant*innen höhere normative Erwartungen gestellt als an alle anderen? Um dies zu beantworten, haben wir eine Umfrage in der Schweiz gemacht, einem konsensorientierten Land mit einer vielfältigen Gesellschaft und hitzigen politischen Debatten über die Integration von Migrant*innen – ein Kontext, der dem der Niederlande nicht unähnlich ist.
Wir befragten Menschen zur Bedeutung sozialer Normen, die typischerweise im Rahmen der Integration verlangt werden, z. B. die Teilnahme am Nachbarschaftsleben, finanzielle Unabhängigkeit, die Einhaltung von Gesetzen und die Teilnahme am politischen Leben. Für die Hälfte der Befragten bezogen sich die Fragen speziell auf Migrant*innen, z. B. „Ausländer sollten regelmäßigen Kontakt zu ihren Nachbarn haben”, während sie sich für die andere Hälfte auf alle Mitglieder der Gesellschaft bezogen, z. B. „Man sollte regelmäßigen Kontakt zu seinen Nachbarn haben”.
Durch den Vergleich dieser beiden Arten der Fragestellung konnten wir analysieren, ob die Menschen tatsächlich höhere normative Erwartungen an Migrant*innen haben als an die Gesellschaft insgesamt. Die Ergebnisse zeigen, dass Migrant*innen strengeren sozialen Normen unterliegen als die Gesellschaft insgesamt, insbesondere in Bezug auf lokales soziales Engagement und die Achtung von Gesetzen und Verfassungswerten. Ein Phänomen, das wir als «Migrationsbias» in sozialen Normen bezeichnen.
Ein Deutschschweizer Phänomen?
Interessanterweise ist der Migrationsbias kontextabhängig, da er sich im deutschsprachigen Teil der Schweiz manifestiert, nicht jedoch im französischsprachigen Teil. Dieser Unterschied ist nicht nur ein statistischer Zufall oder das Ergebnis einer kleineren Stichprobengrösse, sondern spiegelt die tatsächliche Abwesenheit des Migrationsbias in der französischsprachigen Schweiz wider. Während beide Sprachregionen eine ähnliche Zustimmung zu allgemeinen sozialen Normen zeigen, sind die Erwartungen an Migrant*innen im deutschsprachigen Teil deutlich stärker.
Ein Grund für diesen Unterschied könnte darin liegen, wie die beiden Regionen Staatsbürgerschaft und Zugehörigkeit verstehen. Der deutschsprachige Teil der Schweiz tendiert zu einem assimilationistischen Modell der Staatsbürgerschaft, das auf der Idee der kulturellen Homogenität basiert, an die sich Migrant*innen anpassen müssen. Der französischsprachige Teil hingegen ist näher am multikulturalistischen Modell, das auf einem republikanischen (und nicht ethnischen) Verständnis von Staatsbürgerschaft und kultureller Vielfalt basiert.
Die französischsprachigen Kantone neigen eher zu liberaleren und inklusiveren Ansätzen, die der französischen Tradition des ius soli (Staatsbürgerschaft aufgrund des Geburtsortes) ähneln, während die deutschsprachigen Kantone eher restriktivere Ansätze verfolgen, die dem deutschen Modell des ius sanguinis (Staatsbürgerschaft aufgrund der Abstammung) näher kommen.
Dies spiegelt sich in konkreten politischen Maßnahmen wider: So ist beispielsweise das Wahlrecht für Nichtstaatsangehörige in der französischsprachigen Schweiz weit verbreitet, in der Deutschschweiz hingegen nicht. Allgemeiner gesagt orientiert sich die französischsprachige Region stärker an kosmopolitischen Werten und internationaler Offenheit, während die deutschsprachige Region eher zu nationaler Schliessung neigt.
Romantisierte Integrationsvorstellungen
Warum ist dieser Migrationsbias in sozialen Normen von Bedeutung und was sagen die Ergebnisse unserer Studie über das öffentliche Verständnis von Integration? In der Politik wird Integration oft unter lokalen, gemeinschaftsorientierten Gesichtspunkten betrachtet (siehe Anderson 2023) – Migrant*innen werden dazu ermutigt, Vereinen beizutreten, am Leben in der Nachbarschaft teilzunehmen und soziale Kontakte zu knüpfen. Unsere Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass die Öffentlichkeit diese lokalen Vorstellungen von Integration möglicherweise romantisiert und an Migrant*innen höheren Ansprüche stellt als an Bürger*innen.
Für Staatsbürger*innen ist die Teilnahme am lokalen Leben weitgehend eine Frage der freien Entscheidung, Migrant*innen hingegen eine gesellschaftliche Erwartung und ein Bewertungskriterium für ihre Integration. Ihre Beteiligung in der lokalen Gemeinschaft wird sowohl als soziale Norm als auch in der bürokratischen Praxis überwacht und bewertet, was die ungleiche Verteilung normativer Erwartungen widerspiegelt. Diese Kluft – in der Migrationsforschung als «Integrationsdispensation» bezeichnet – schafft einen Doppelstandard: Staatsbürger*innen bleiben von formeller und informeller Kontrolle verschont, während Migrant*innen nach strengeren Maßstäben beurteilt werden.
Politische Folgen
Der Migrationsbias hat weitreichende politische Folgen. Gelten für alle die gleichen sozialen Normen? Verstärkt die Tatsache, dass die Integrationspolitik nur auf Migrant*innen abzielt, nicht gerade jene Trennung, die sie zu überbrücken vorgibt, sodass die Integrationspolitik selbst zum Problem wird? Und ist es mit demokratischen Werten vereinbar, von Migrant*innen zu verlangen, dass sie sich zu Normen bekennen, die von Bürger*innen nicht in gleichem Maße erwartet und eingefordert werden (Manser-Egli 2025)?
Kommen wir auf unsere Eingangsfrage zurück: Die Antwort ist einfach: (a) einen geeigneten Termin mit Sue vereinbaren, um auf einen Kaffee vorbeizukommen. In Tat und Wahrheit gibt es hier natürlich keine richtige oder falsche Antwort – und keine der vorgeschlagenen Antworten ist besonders „niederländisch” oder „un-niederländisch”. Der Punkt ist ein anderer: Wenn es um soziale Normen geht, wird Migrant*innen nicht derselbe Spielraum gewährt wie Staatsbürger*innen. Diesen Bias zu verstehen ist entscheidend, um den Werten der Freiheit und der Gleichheit in der liberalen Demokratie gerecht zu werden.
Referenzen
- Anderson, Bridget. 2023. ‘Integration: A Tale of Two Communities’. Mobilities 18 (4): 606–19.
- Manser-Egli, Stefan. 2025. ‘Illiberal integrationism: shared values as an integration requirement in liberal democracy.‘ Journal of Political Power, 1-20.
- Manser-Egli, Stefan, and Philipp Lutz. 2025. ‘Integration for whom? The migration bias in social norms.‘ European Societies, 1-16.
- Orgad, Liav. 2015. The Cultural Defense of Nations: A Liberal Theory of Majority Rights. Oxford; New York: Oxford University Press.
- Schinkel, Willem. 2018. ‘Against “Immigrant Integration”: For an End to Neocolonial Knowledge Production.’Comparative Migration Studies 6 (31): 1–17.
Bild: unsplash.com
Bemerkung: dieser Blogbeitrag wurde ursprünglich vom “nccr – on the move” am 5. November 2025 veröffentlicht. Alle Rechte vorbehalten